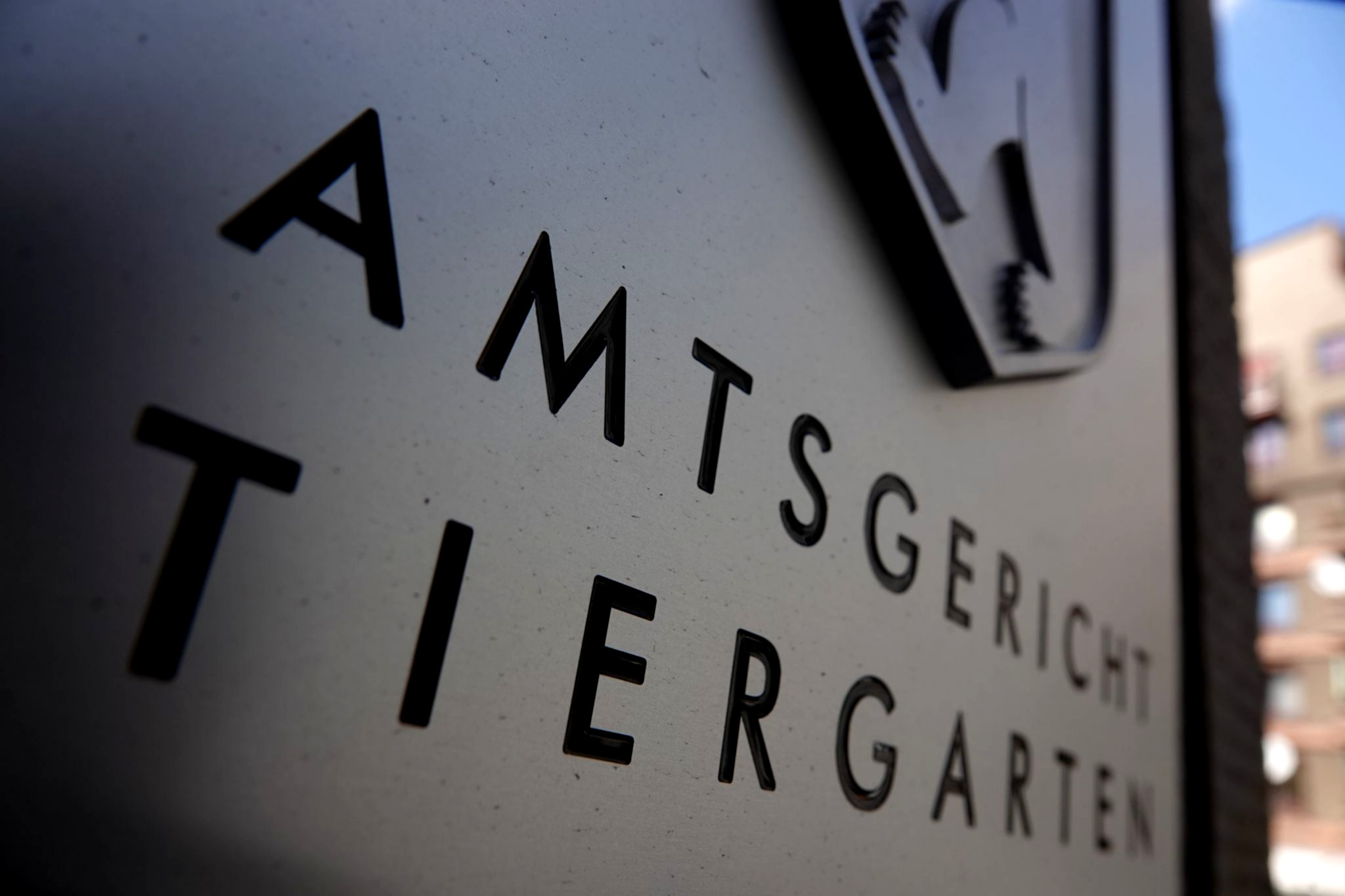Die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist seit vielen Jahren ein Thema in der Öffentlichkeit. Das teils besetzte Gebäude in der Rigaer Straße 94, bekannt als Symbol der linksautonomen Szene, ist wieder Ort eines juristischen Schlagabtauschs. Im Mittelpunkt steht die "Kadterschmiede", eine linksautonome Kneipe, die von Aktivisten betrieben wird und als Treffpunkt der Szene fungiert. Am Mittwoch wird das Landgericht Berlin die Räumungsklage der Eigentümergesellschaft gegen den Verein, der die Räume in der Rigaer Straße 94 nutzt, erneut prüfen. Die gerichtliche Auseinandersetzung ist das neueste Kapitel eines langwierigen Konflikts, der Polizei, Justiz und Politik seit geraumer Zeit beschäftigt.
In der Rigaer Straße 94 ist das Gebäude mehr als nur ein Wohnhaus. Es ist ein Zeichen für einen politischen und gesellschaftlichen Streit, der weit über Berlin hinaus diskutiert wird. Der Eigentümer versucht seit Jahren, die Kadterschmiede aus dem Seitenflügel des Hauses zu entfernen. Die Betreiber haben keinen offiziellen Mietvertrag. Frühere Klagen scheiterten aus formalen Gründen, vor allem wegen der Prozessunfähigkeit der Eigentümergesellschaft, deren Verwaltungssitz in England ist. Der Fall wird nun erneut vor Gericht verhandelt. Es liegt nun am Landgericht Berlin zu prüfen, ob alle formalen Voraussetzungen diesmal erfüllt sind, damit es inhaltlich über die Räumung entscheiden kann.
Die Lage um die Rigaer 94 steht sinnbildlich für den Konflikt zwischen Eigentumsrechten und alternativen Wohn- und Lebensformen in Städten. Während der Eigentümer auf sein Recht zur Nutzung und Verwaltung des Gebäudes pocht, betrachten die Bewohner und Unterstützer der Kadterschmiede das Haus als einen wichtigen Freiraum für alternative Kultur und politische Arbeit. In der Vergangenheit sind massive Proteste, Polizeieinsätze und politische Debatten immer wieder aufgetreten. Die Konflikte sind von einem tiefen Misstrauen und von juristischen Feinheiten geprägt, die den Verlauf der Verfahren entscheidend beeinflussen können.
Die aktuelle Räumungsklage ist Teil einer langen Reihe von juristischen Auseinandersetzungen über die Rigaer Straße. Berliner Justizquellen berichten, dass im Jahr 2025 noch insgesamt 13 Verfahren im Zusammenhang mit dem Gebäudekomplex anhängig sind – neben der Klage gegen die Kneipe sind es auch mehrere Verfahren gegen die Hausbewohner. Die fortdauernden Abläufe zeigen, wie kompliziert und vielschichtig die Situation ist. Die Gerichte versuchen, basierend auf der aktuellen Rechtslage, Entscheidungen zu treffen, doch die gesellschaftliche Debatte über Gentrifizierung, alternative Lebensentwürfe und das Recht auf Stadt ist nach wie vor sehr aktuell. Die Entscheidung des Landgerichts Berlin könnte eine Signalwirkung entfalten – für die linksautonome Szene ebenso wie für Eigentümer und Investoren in der Hauptstadt.
Die Geschichte der Rigaer 94: Ein Symbol des Widerstands
Die Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain hat seit den frühen 1990er Jahren eine turbulente Geschichte. Nach der Wende wurde das Gebäude, wie viele andere in Ost-Berlin, zunächst von Wohnungslosen und politischen Aktivistengruppen besetzt. In Berlin, nach dem Mauerfall, erlebte die Hausbesetzerbewegung einen Aufschwung; sie sah sich als Antwort auf die drohende Verdrängung durch steigende Mieten und die Kommerzialisierung des Wohnraums. In kurzer Zeit wurde die Rigaer 94 zu einem wichtigen Treffpunkt für die linksautonome Szene der Stadt.
Der Gebäudekomplex umfasst mehrere miteinander verbundene Häuser und einen Seitenflügel. Das Haus wurde seit den 1990er Jahren teilweise legalisiert; während einige Bewohner Mietverträge erhielten, blieben andere Teile weiterhin besetzt. Im Seitenflügel entstand die Kadterschmiede, eine Kneipe, die als Treffpunkt für alternative Kultur und politische Diskussionen dient. Im Laufe der Zeit ist die Rigaer 94 zu einem Symbol des Widerstands gegen Gentrifizierung und die kapitalistische Stadtentwicklung geworden.
Die Konflikte zwischen den Bewohnern, der Polizei und den Behörden waren immer wieder zu beobachten. Umfangreiche Polizeieinsätze bei Räumungen und Durchsuchungen waren Höhepunkte, die regelmäßig bundesweite Debatten über das Verhältnis von Staat und alternativen Wohnformen auslösten. Die Rigaer 94 ist ein Symbol für einen "linken Freiraum" geworden, der Solidarität und Ablehnung zugleich hervorruft. Befürworter betrachten das Haus als einen wichtigen Schutzraum für politisch und sozial Benachteiligte, während Gegner die teilweise rechtsfreien Zustände im und um das Gebäude kritisieren.
Über Jahrzehnte waren die Eigentumsverhältnisse unklar und erlebten mehrere Wechsel. Eine Gruppe von Investoren, die auf eine Wertsteigerung des Objekts hofften, traf auf eine Bewohnerstruktur, die sich vehement gegen jegliche Form der Kommerzialisierung zur Wehr setzte. Die Kadterschmiede war dabei von großer Bedeutung, nicht nur als Kneipe, sondern auch als Veranstaltungsort für Konzerte, Lesungen und politische Debatten. Die Frage, ob sie weiterhin bestehen wird, ist von grundlegender Bedeutung für die Szene.
In den letzten Jahren hat sich der Konflikt verschärft, weil die neuen Eigentümer versuchten, das Haus zu modernisieren und zu räumen. Die wiederholten gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Kadterschmiede sind ein Beispiel für den hartnäckigen Widerstand der Anwohner und ihrer Unterstützer. Trotz aller Bemühungen von Behörden und Eigentümern, das Projekt zu beenden, bleibt die Rigaer 94 auch im Jahr 2025 ein zentraler Streitpunkt um alternative Wohn- und Lebensformen in Berlin.
Die Kadterschmiede: Treffpunkt der Linksautonomen
Die Kadterschmiede ist nicht einfach nur eine Berliner Kneipe; sie ist weit mehr als das. Sie ist ein sozialer und politischer Knotenpunkt, ein Raum für Netzwerke und Widerstand. Seit ihrer Eröffnung wurde sie als Veranstaltungsort für politische Gruppen genutzt, als Bühne für alternative Kulturprojekte und als Rückzugsort für Bewohner und Unterstützer der linken Szene. Die Nutzer haben die Räume im Seitenflügel der Rigaer 94 eigenständig umgebaut und gestaltet. Politische Symbolik, Graffiti und ein Gefühl der Solidarität prägen die Atmosphäre.
Die Kadterschmiede verfolgt, im Gegensatz zu gewerblichen Bars und Clubs, ein nicht-kommerzielles Konzept. Getränke sind zu niedrigen Preisen erhältlich, und der Gewinn dient dem Unterhalt der Räumlichkeiten oder fließt in politische Projekte. Alles, von Diskussionsabenden über Filmvorführungen bis hin zu Konzerten und Flohmärkten, gehört zu den regelmäßigen Veranstaltungen. Die Kneipe ist ein offener Raum für alle, die sich mit Solidarität und Antikapitalismus identifizieren.
Die Kadterschmiede ist für die linksautonome Szene Berlins von enormer Bedeutung. Sie ist ein Knotenpunkt für diverse Initiativen, wie Antifa-Gruppen, feministischen Kollektiven und Nachbarschaftsprojekten. In den letzten Jahren wurden von diesem Ort aus viele Demonstrationen und Aktionen organisiert. Selbst in Zeiten großer Repression durch Polizei und Justiz war die Kadterschmiede ein wichtiger Anlaufpunkt für die Szene.
Die Räumungsklagen gegen die Kneipe sind für viele nicht nur eine juristische Angelegenheit – sie sehen darin einen Angriff auf die gesamte linksautonome Infrastruktur. Die Betreiber sind der Ansicht, dass die Schließung der Kadterschmiede einen wichtigen Raum für politische Bildung und zivilgesellschaftliches Engagement verlieren würde. Im Gegensatz dazu sehen Kritiker in der Kneipe einen Rückzugsort für gewaltbereite Gruppen, der das staatliche Gewaltmonopol untergräbt.
Im Jahr 2025 steht die Zukunft der Kadterschmiede wieder auf der Kippe. Die Betreiber und ihre Unterstützer haben sich durch die immer wiederkehrenden juristischen Auseinandersetzungen mobilisiert. Die Szene beobachtet den aktuellen Prozess vor dem Landgericht Berlin aufmerksam, weil das Ergebnis möglicherweise Signalwirkung für andere Projekte ähnlicher Art haben könnte. Die Kadterschmiede bleibt ein zentraler Ort für den Streit um Freiräume, Eigentum und alternative Lebenskonzepte in Berlin.
Die rechtliche Ausgangslage: Eigentum versus alternatives Wohnen
Die rechtliche Auseinandersetzung um die Kadterschmiede in der Rigaer 94 illustriert perfekt den Konflikt zwischen Eigentumsrechten und alternativen Wohnformen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, wie sehr Eigentümer ihr Recht auf Nutzung und Verwaltung ihres Besitzes gegen den Widerstand unrechtmäßiger Bewohner und Nutzer durchsetzen können. Die Eigentümergesellschaft der Rigaer 94, die seit einigen Jahren in England verwaltet wird, besteht auf ihrem Recht, die Nutzung der Räumlichkeiten selbst zu bestimmen und nicht genehmigte Nutzungen zu unterbinden.
Das Mietrecht in Deutschland sieht grundsätzlich vor, dass Eigentümer entscheiden können, wie sie ihre Immobilie nutzen. Eine Nutzung ohne Mietvertrag, wie sie bei der Kadterschmiede besteht, ist aus juristischer Sicht normalerweise unzulässig. In einem solchen Fall kann der Eigentümer eine Räumungsklage einreichen, um die Räume zurückzufordern. Die Gerichte haben dann zu prüfen, ob die Klage formell und materiell-rechtlich zulässig ist und ob ein Räumungsanspruch besteht.
In Bezug auf die Rigaer 94 scheiterte eine vorherige Klage der Eigentümergesellschaft, weil das Gericht sie aufgrund ihres Verwaltungssitzes in England für nicht prozessfähig hielt. Im Januar 2023 bestätigte das Kammergericht Berlin diese Einschätzung und erklärte die Klage für unzulässig. Im Verfahren 2025 wird nun erneut untersucht, ob die Gesellschaft mittlerweile alle formalen Voraussetzungen erfüllt und somit klagebefugt ist.
Ein weiteres juristisches Problemfeld betrifft "teilbesetzte Häuser". In Berlin sind viele Gebäude zu finden, in denen ein Teil der Wohnungen legal vermietet ist, während andere Teile besetzt sind oder von Nutzern ohne Mietvertrag bewohnt werden. Es ist oft schwierig, Eigentumsrechte in solchen Fällen durchzusetzen, weil die Identität der Nutzer oft nicht klar feststellbar ist und die Bewohnerinnen und Bewohner sich auf faktische Besitzverhältnisse und Gewohnheitsrechte berufen können.
Andererseits vertreten die Nutzer der Kadterschmiede und ihre Befürworter die Ansicht, dass das Stadtrecht nicht ausschließlich an Eigentum gebunden sein dürfe. Mit Hinweis auf soziale und politische Aspekte verlangen sie, dass alternative Wohn- und Lebensmodelle im bestehenden Rechtssystem mehr Berücksichtigung finden. Die Diskussion über das Verhältnis von Eigentum, Nutzung und öffentlichem Interesse bleibt somit ein wichtiges Thema – nicht nur in der Rigaer 94, sondern in vielen deutschen Städten.
Die Rolle der Justiz: Gerichte im Spannungsfeld
Die Berliner Justiz hat es im Fall der Rigaer Straße 94 mit einer komplizierten Gemengelage zu tun. Neben den formalen Kriterien müssen die Gerichte auch den gesellschaftlichen Kontext der Streitigkeiten berücksichtigen. Die 13 laufenden Prozesse im Jahr 2025, die laut Justizangaben noch rund um das Gebäude anhängig sind, zeigen, wie dauerhaft und vielschichtig dieser Konflikt ist.
Die Verfahren haben unterschiedliche Zielsetzungen. Neben der aktuellen Räumungsklage gegen die Kadterschmiede sind auch viele Klagen gegen einzelne Bewohner anhängig. Oftmals sind herausfordernde Beweislagen, unklare Mietverhältnisse und wechselnde Besitzverhältnisse betroffen. Die Abwägung zwischen dem Prinzip der Rechtssicherheit und den besonderen sozialen Umständen ist die Herausforderung, der sich die Gerichte stellen müssen.
Eine große Herausforderung für die Justiz ist es, dass viele Nutzer der Räume anonym bleiben oder sich nicht eindeutig identifizieren lassen. Es gab immer wieder Fälle, in denen Klagen ins Leere liefen, weil keine konkrete Person als Beklagte benannt war. Gerichtliche Entscheidungen werden zudem oft von Protesten und öffentlichen Debatten begleitet, was zusätzlichen Druck auf die Justiz ausübt.
In den letzten Jahren haben die Berliner Gerichte versucht, einen Kompromiss zu finden. Obwohl sie grundsätzlich die Eigentumsrechte anerkennen, haben sie immer wieder betont, dass soziale Belange und die besondere Situation in der Rigaer Straße berücksichtigt werden müssen. Es kam vor, dass Räumungsklagen abgewiesen wurden, weil das Gericht der Meinung war, die Klage sei nicht richtig eingereicht oder begründet worden. In anderen Fällen erhielten die Eigentümer Recht, was teils zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Bewohnern führte.
Der Prozess gegen die Kadterschmiede wird aus diesem Grund nicht nur juristisch, sondern auch politisch genau verfolgt. Die Entscheidung des Landgerichts könnte als Präzedenzfall für ähnliche Fälle fungieren und eine Signalwirkung für die Zukunft alternativer Projekte in Berlin und anderen Städten haben. Damit steht die Justiz im Spannungsfeld zwischen dem, was sie rechtlich entscheiden sollte, den Erwartungen der Gesellschaft und dem Druck der Politik.
Die Positionen der Eigentümer: Interessen, Strategien und Herausforderungen
Die Eigentümergesellschaft der Rigaer 94 hat seit vielen Jahren das Vorhaben, den Gebäudekomplex zu modernisieren und ihm eine neue Nutzung zu geben. Aus der Perspektive der Eigentümer sind das Wahrnehmen des Eigentumsrechts und die Kontrolle über die Nutzung des eigenen Besitzes die zentralen Anliegen. Die Kadterschmiede und andere besetzte Bereiche des Hauses gelten als Hindernis für die Entwicklung des Objekts.
Die Eigentümer sind der Meinung, dass ihnen durch die illegale Nutzung der Räume erhebliche finanzielle Einbußen entstehen. Es entgeht Ihnen nicht nur der Mieterlös – auch erforderliche Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen können nicht umgesetzt werden, solange wesentliche Teile des Gebäudes bewohnt sind. Außerdem werden Schwierigkeiten mit der Versicherung, Sicherheitsmängel und der Verlust an Marktwert angesprochen.
Die Eigentümer haben in den letzten Jahren unterschiedliche Ansätze verfolgt, um die Nutzung der Räume durch unbefugte Dritte zu verhindern. Das umfasste sowohl Gespräche mit einzelnen Bewohnern als auch mehrere Versuche, gerichtliche Räumungstitel zu erlangen. Die wechselnden Eigentumsverhältnisse, die teils unklaren Strukturen und die internationale Verflechtung – der Verwaltungssitz der Gesellschaft liegt in England – machten es jedoch schwierig, ihre Ansprüche durchzusetzen.
Ein weiteres Problemfeld sind die politischen und gesellschaftlichen Reaktionen auf Räumungen. Protestaktionen der linksautonomen Szene begleiten jeden Versuch, Teile des Hauses zu räumen. In der Vergangenheit kam es nicht selten zu Sachbeschädigungen, Auseinandersetzungen mit der Polizei und öffentlicher Kritik an den Eigentümern. Aus diesem Grund haben viele Investoren Angst, sich in solchen Objekten zu engagieren – die Rigaer 94 gilt in Immobilienkreisen als "Problemimmobilie".
Im Jahr 2025 werden die Eigentümer auf ein konsequentes juristisches Vorgehen setzen. Die Räumungsklage gegen die Kadterschmiede soll einen Präzedzienfall schaffen, um auch gegen andere besetzte Räume im Haus vorgehen zu können. Zur gleichen Zeit sind die Eigentümer auf der Suche nach Möglichkeiten, die gesellschaftliche Debatte zu beeinflussen und die Legitimität ihres Anliegens zu zeigen. Die Auseinandersetzung mit der linksautonomen Szene ist jedoch eine Herausforderung, die über juristische Fragestellungen hinausgeht.
Die Perspektive der Bewohner und Unterstützer: Widerstand und Solidarität
Die Bewohner der Rigaer 94 und ihre Unterstützer sehen die aktuelle Räumungsklage als Teil eines umfassenden Angriffs auf alternative Wohn- und Lebensformen. Für viele Menschen ist das Haus weit mehr als nur ein Wohnort – es steht als Symbol im Kampf gegen Gentrifizierung, soziale Ausgrenzung und die Kommerzialisierung des städtischen Raums. Die Kadterschmiede ist dabei ein wichtiger sozialer und politischer Treffpunkt.
Die Anwohner betonen, dass die Rigaer 94 ein wichtiger Schutzraum für diejenigen ist, die auf dem regulären Wohnungsmarkt kaum Chancen haben. In den letzten Jahren sind die Mietpreise in Berlin durch die Decke gegangen, und zahlreiche alternative Projekte wurden bereits verdrängt. Die Rigaer 94 stellt für sie ein seltenes Relikt aus der Zeit dar, als selbstorganisierte Lebensentwürfe noch möglich waren. Die alternative Nutzung der Räume wird als ein legitimer Ausdruck von Selbstbestimmung und Solidarität angesehen.
Die Bewohner und ihre Unterstützer setzen auf verschiedene Strategien, wenn es um die Räumungsklagen geht. Neben der juristischen Verteidigung – wie etwa durch das Anfechten der Klagebefugnis der Eigentümergesellschaft – ist die öffentliche Mobilisierung von großer Bedeutung. Um die Aufmerksamkeit auf die Situation zu lenken und politischen Druck zu erzeugen, werden immer wieder Demonstrationen, Informationsveranstaltungen und Solidaritätsaktionen organisiert. Die Unterstützung geht weit über Berlin hinaus – bundesweit und sogar international gibt es Solidaritätsbekundungen für die Bewohner der Rigaer 94.
Die linksautonome Szene betrachtet die Räumungsversuche als einen Angriff auf die gesamte Infrastruktur der alternativen Projekte in Berlin. Die Räumung vergleichbarer Projekte, wie der Liebig 34 oder der Köpi, hat in der Vergangenheit massive Proteste und teilweise gewaltsame Auseinandersetzungen zur Folge gehabt. Die Furcht vor einer weiteren Verdrängung alternativer Lebensformen ist in der Szene omnipräsent.
Im Jahr 2025 sind die Bewohner der Rigaer 94 zwar angespannt, aber sie kämpfen weiterhin. Die neue Klage gegen die Kadterschmiede wird als Testfall angesehen, der Auswirkungen auf zahlreiche ähnliche Projekte haben könnte. Die Bewohner haben sich fest vorgenommen, ihren Widerstand fortzusetzen – wenn nötig, auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Für sie ist es weit mehr als nur der Erhalt einer Kneipe: Es geht um das Recht auf Stadt, um Selbstbestimmung und die Verteidigung von Freiräumen gegen die Interessen von Investoren und Behörden.
Politische und gesellschaftliche Reaktionen: Stadt im Spannungsfeld
Die erneute Räumungsklage gegen die Kadterschmiede hat in Berlin und darüber hinaus eine umfassende gesellschaftliche und politische Diskussion angestoßen. Die Stadt ist seit Jahren zwischen den Interessen von Investoren, Behörden und alternativen Projekten gefangen. Der Umgang mit besetzten Häusern und linken Freiräumen ist zu einem Symbolthema geworden, das die Ausrichtung der Stadtpolitik prägt.
In der Berliner Landespolitik herrscht über diese Frage eine tiefe Spaltung. Während konservative und wirtschaftsnahe Kräfte die "Rechtsstaatlichkeit" durch die konsequente Durchsetzung von Eigentumsrechten fordern, verlangen linke und grüne Parteien, dass soziale Belange stärker berücksichtigt werden. Es wird immer wieder gefordert, alternative Projekte wie die Kadterschmiede durch Mietverträge oder das Erbbaurecht abzusichern, um sie vor Verdrängung zu schützen.
Die Debatte über die Rigaer 94 ist untrennbar mit der Diskussion über Gentrifizierung in Berlin verbunden. In den letzten Jahren haben viele Stadtteile, vor allem Friedrichshain-Kreuzberg, große Veränderungen durchgemacht. Die sozialen Spannungen in der Stadt haben durch steigende Mieten, Luxussanierungen und die Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen erheblich zugenommen. Viele sehen die Rigaer 94 und ähnliche Projekte als letzte Bastionen im Kampf gegen die "Durchkommerzialisierung" der Stadt.
Auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen nehmen Stellung. Mietervereine, Sozialverbände und Nachbarschaftsinitiativen betrachten die Entwicklungen rund um die Rigaer 94 als ein Menetekel für den Umgang mit bezahlbarem Wohnraum in Berlin. Sie weisen auf die sozialen Konsequenzen hin, wenn man weiterhin alternative Projekte verdrängt, und verlangen eine Stadtentwicklungspolitik, die sozialer ist.
Es gibt jedoch auch Meinungen, die ein strengeres Vorgehen gegen illegale Besetzungen fordern. Vor allem Anwohner und Gewerbetreibende beklagen immer wieder Sicherheitsprobleme, Sachbeschädigungen und die Angst vor Eskalationen während Demonstrationen. Die Polizei hingegen wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie mit ihren großen Einsätzen die Lage verschärft und zu hart gegen die Szene vorgeht.
Die Diskussion über die Kadterschmiede ist ein Spiegelbild der tiefere Konflikte über Stadt, Eigentum und soziale Gerechtigkeit. Sie verdeutlicht, wie schwierig es ist, einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen zu finden – und wie sehr die Frage, wie man mit alternativen Projekten umgeht, zur Nagelprobe für die politische Kultur Berlins geworden ist.
Perspektiven für die Zukunft: Signalwirkung über Berlin hinaus
Die Räumungsklage gegen die Kadterschmiede in der Rigaer Straße 94 ist ein Verfahren, das möglicherweise die Zukunft alternativer Projekte in ganz Deutschland beeinflussen könnte. Bundesweit gilt das Verfahren als ein Testfall, der eine Signalwirkung dafür haben könnte, wie man mit besetzten Häusern und linksautonomen Treffpunkten umgeht. Mit großem Interesse verfolgen sowohl Befürworter als auch Gegner den Prozess in Berlin.
Wenn das Landgericht Berlin der Klage der Eigentümergesellschaft stattgibt, könnte dies einen Präzedzfall schaffen, der es Investoren und Eigentümern erleichtert, gegen ähnliche Projekte vorzugehen. Die Argumentation des Gerichts zur Klagebefugnis und zur materiell-rechtlichen Situation wird in juristischen Fachkreisen bereits jetzt intensiv erörtert. Städte wie Hamburg und Leipzig, die ähnliche Herausforderungen haben, könnten sich an der Entscheidung Berlins orientieren.
Viel steht für die linksautonome Szene auf dem Spiel. Die Kadterschmiede ist eines der letzten großen Projekte dieser Art in der Hauptstadt. Eine Räumung würde nicht nur einen wichtigen Treffpunkt verlieren, sondern könnte auch andere Projekte demotivieren, die sich gegen Verdrängung zur Wehr setzen. Eine Niederlage vor Gericht könnte gleichzeitig die Szene zu neuen Protestformen und einer stärkeren Vernetzung motivieren.
Die Politik muss die gesellschaftlichen Spannungen angehen. Die Frage, wie man mit alternativen Wohn- und Kulturprojekten umgehen soll, ist nach wie vor sehr relevant. Es gibt Forderungen nach einer Reform des Mietrechts, um Platz für selbstorganisierte Projekte zu schaffen. Andere setzen auf eine strikte Umsetzung des Eigentumsrechts. Die Diskussion über die Rigaer 94 wird somit zur Nagelprobe für die zukünftige Entwicklung der Stadt – und vielleicht sogar für ganz Deutschland.
Im Jahr 2025 bleibt die Lage angespannt. Egal, wie der aktuelle Prozess ausgeht, es ist schon jetzt klar, dass der Streit um die Rigaer 94 und die Kadterschmiede weitergehen wird. Die grundlegenden Prinzipien des städtischen Zusammenlebens werden hier in Frage gestellt: Wem gehört die Stadt? Wer trifft die Entscheidung über die Nutzung des Raums? Und wie lässt sich ein Ausgleich zwischen den Interessen von Eigentümern, Bewohnern und der Allgemeinheit schaffen? Die Antworten darauf werden nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland sehnlichst erwartet.