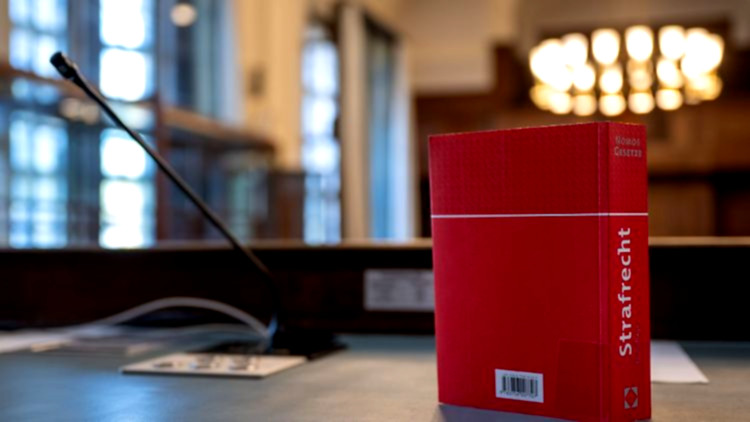In Brandenburg sind in den letzten Monaten die Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund alarmierend angestiegen. Im Zeitraum von April bis Juni 2025 erfasste das Innenministerium insgesamt 870 Delikte, die unter "Politisch motivierte Kriminalität – rechts" fallen. Dies ist im Vergleich zu den 796 Fällen des Vorquartals erheblich gestiegen. Die Entwicklung zeigt sich nicht nur durch statistische Relevanz, sondern auch durch gravierende Einzelfälle, die das gesellschaftliche Klima im Bundesland zunehmend belasten. Von Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen über Körperverletzungen bis hin zu Messerangriffen und Flaschenwürfen umfasst die Bandbreite der Taten alles Mögliche. Die häufige und brutale Natur solcher Vorfälle bekräftigt, wie dringend das Problem angegangen werden muss.
Besonders auffällig ist die Zunahme der Gewaltstraftaten. Im ersten Quartal 2025 wurden noch 19 dieser Delikte registriert, doch im zweiten Quartal stieg die Zahl auf 35 – das ist fast eine Verdopplung. Häufig handeln die Täter aus gruppendynamischen Motiven und scheuen sich nicht, ihre Taten zu filmen oder sie sogar öffentlich zu feiern. Vor allem die Verwendung von Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken zur Verbreitung von rechtsextremer Propaganda wird dabei immer wichtiger. Entwicklungen dieser Art deuten auf eine besorgniserregende gesellschaftliche Veränderung hin und bringen große Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft mit sich.
Ein weiteres besorgniserregendes Zeichen ist die Anzahl der registrierten Rechtsextremisten in Brandenburg. Ein neuer Höchstwert wurde laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht im Jahr 2025 mit 3.650 Personen erreicht. Die zunehmende Präsenz von rechtsextremen Akteuren ist nicht nur durch einen Anstieg der Straftaten zu beobachten; sie erlangen auch politischen und gesellschaftlichen Einfluss in bestimmten Regionen. Kommunalpolitiker und Bürgermeisterinnen warnen vor einer Angstspirale und verlangen, dass das Problem nicht länger ignoriert, sondern aktiv bekämpft wird. Die meisten Delikte sind nach wie vor die Verwendung verfassungswidriger Symbole und Propagandadelikte. Aber auch schwere Gewalt- und Hassverbrechen steigen und sie treffen oft Menschen mit Migrationshintergrund oder politische Gegner.
Die Veränderungen in Brandenburg sind nicht isoliert, sondern Teil eines bundesweiten Trends. Trotzdem sind spezifische regionale Besonderheiten erkennbar, die eine differenzierte Betrachtung notwendig machen. Im Fokus der aktuellen Debatte stehen die Ursachen, die gesellschaftlichen Auswirkungen und die passenden Gegenmaßnahmen. Die wichtigsten Aspekte dieses Themas werden in acht Abschnitten betrachtet.
Die Entwicklung der Straftatenzahlen: Eine besorgniserregende Dynamik
Die Kriminalitätsstatistik von 2025 zeigt eine kontinuierliche und besorgniserregende Zunahme der rechtsextremistisch motivierten Straftaten in Brandenburg. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität – rechts – wurde im ersten Quartal bereits eine hohe Zahl von 796 Delikten registriert, die im zweiten Quartal auf 870 anstieg. Das ist eine fast zehnprozentige Steigerung in nur drei Monaten. Besonders alarmierend ist der Anstieg der Gewaltstraftaten: Sie sind von 19 Fällen im ersten Quartal auf 35 im zweiten Quartal gestiegen, was fast 84 Prozent ausmacht.
Den Angaben der Polizeistatistik zufolge handelt es sich bei den erfassten Straftaten überwiegend um Propagandadelikte, Volksverhetzung und die Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen. Die Mehrheit der Fälle geht auf das öffentliche Zurschaustellen von Symbolen verfassungswidriger Organisationen zurück. Über 500 der erfassten Straftaten beziehen sich auf diesen Bereich, was zeigt, wie wichtig Symbolik und ideologische Selbstdarstellung für die rechtsextreme Szene sind.
Allerdings ist die Zunahme schwerwiegenderer Straftaten nicht zu unterschätzen. Die Gewalt gegen Menschen – vor allem gegen solche mit Migrationshintergrund, politische Gegner und Minderheiten – steigt. Die Straftaten umfassen Körperverletzungen, gefährliche Angriffe mit Messern und Flaschen sowie Sachbeschädigungen an Privat- und Geschäftseigentum. Auch die Bevölkerung nimmt diese Entwicklung wahr; immer öfter ist von einem Klima der Angst und Unsicherheit die Rede.
Die Dunkelziffer ist ein weiteres Problemfeld. Es wird angenommen, dass eine Vielzahl von Taten nicht zur Anzeige gebracht wird oder dass sie während der Ermittlungen nicht eindeutig dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden können, so die Einschätzung der Experten. Die Polizei und das Innenministerium machen deutlich, dass die Anzahl der Straftaten durch Nachmeldungen und Korrekturen nach Abschluss der Ermittlungen noch steigen kann. Die aktuelle Statistik stellt somit nur eine Momentaufnahme dar, die das tatsächliche Ausmaß der rechtsextremen Kriminalität möglicherweise noch unterschätzt.
Die steigende Zahl der Delikte ist Teil einer bundesweiten Entwicklung, aber in Brandenburg ist sie besonders ausgeprägt. Es gibt viele Gründe dafür, angefangen bei einer erstarkenden rechtsextremen Szene über gesellschaftliche Polarisierung bis hin zu bestimmten regionalen Gegebenheiten. Die immer weiter steigenden Straftatenzahlen machen es dringend erforderlich, dass Politik, Gesellschaft und Polizei diesem Problem begegnen.
Täterprofile und Motivlagen: Wer steht hinter den Taten?
Ein Blick auf die Täterprofile von rechtsextremistischen Straftaten in Brandenburg zeigt eine komplexe Situation. Die Szene ist vielfältig und umfasst sowohl Einzelakteure als auch organisierte Gruppen. Ein erheblicher Teil der Täter stammt aus dem Umfeld rechtsextremer Parteien, Kameradschaften und loser Netzwerke, die sich vor allem über soziale Medien und Messenger-Dienste organisieren. Es sind oft junge Männer im Alter von 16 bis 35 Jahren, die durch ideologische Radikalisierung, den Einfluss von Gruppen oder persönliche Frustration motiviert sind.
Die Täter haben unterschiedliche Motivlagen, doch diese zeigen auch gemeinsame Muster auf. Die Hauptursachen für die meisten Delikte sind Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Verschwörungserzählungen, Nationalismus und ein völkisches Weltbild, das Ausgrenzung und Abwertung von Minderheiten propagiert, laden diese Motive ideologisch auf. Oftmals sehen sich die Täter als "Verteidiger des Abendlandes" und glauben, mit ihren Aktionen gegen eine angebliche "Überfremdung" oder den "Verlust nationaler Identität" zu kämpfen.
Es ist ebenfalls bemerkenswert, wie sehr Online- und Offline-Aktivitäten immer mehr miteinander verwoben werden. In einschlägigen Chatgruppen wird rechtsextremistische Propaganda, Hassbotschaften und Gewaltaufrufe verbreitet, die dann auch auf die Straße gelangen. Übergriffe werden häufig in sozialen Netzwerken dokumentiert und zur Schau gestellt, um Gleichgesinnte zu beeindrucken oder Nachahmer zu animieren. Die Täter machen sich die Anonymität und die große Reichweite digitaler Medien zunutze, um ihre Ideologie zu verbreiten und neue Anhänger zu gewinnen.
Ein weiterer Punkt ist die Bedeutung von Rückzugsräumen und Treffpunkten, die als Knotenpunkte der Szene fungieren. In bestimmten Gebieten Brandenburgs sind regelrechte Hotspots entstanden, an denen rechtsextreme Gruppen besonders aktiv sind. Dort erfolgt nicht nur die Planung von Aktionen; auch die Rekrutierung und Radikalisierung neuer Mitglieder findet statt. Es ist eine Herausforderung für die Polizei, diese Strukturen frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen.
Ein Blick auf die persönliche Biografie vieler Täter zeigt oft soziale Benachteiligung, Perspektivlosigkeit und das Fehlen stabiler Beziehungen auf. In ländlichen Gebieten, die von strukturellen Problemen betroffen sind, bieten rechtsextreme Ideologien für manche Menschen eine scheinbare Identität und Zugehörigkeit. Um der Radikalisierung junger Menschen entgegenzuwirken, sollte die Präventionsarbeit nicht nur repressiv, sondern auch sozialpädagogisch ansetzen.
Typologie der Straftaten: Vom Symbol bis zur Gewalttat
In Brandenburg umfasst die Bandbreite rechtsextremistisch motivierter Straftaten alles von Propagandadelikten und Volksverhetzung bis hin zu schweren Gewalttaten. Die Polizei kategorisiert die verschiedenen Deliktarten, die unterschiedliche Schweregrade und gesellschaftliche Auswirkungen aufweisen.
Propagandadelikte machen den zahlenmäßigen Schwerpunkt aus. Dies umfasst die Verbreitung und Nutzung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen, wie Hakenkreuzen, SS-Runen und weiteren Emblemen aus dem Nationalsozialismus. In der Szene dienen diese Straftaten der Selbstdarstellung und sollen Macht und Präsenz demonstrieren. Sie werden oft im öffentlichen Raum begangen, zum Beispiel durch Schmierereien an Gebäuden, Denkmälern oder Verkehrsmitteln.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Volksverhetzung. Es geht um öffentliche Äußerungen, die Hass gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schüren oder sie herabwürdigen. Immer häufiger werden solche Inhalte über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste verbreitet, aber auch über Flugblätter, Plakate oder Aufkleber im öffentlichen Raum.
Die Fälle von Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sind besonders schwerwiegend. Dazu gehören Angriffe mit Messern, Schlägen oder Flaschenwürfen, die in den vergangenen Monaten immer wieder festgehalten wurden. Opfer sind oft Menschen mit Migrationshintergrund, politische Gegner oder Mitglieder von Minderheiten. So etwas hat nicht nur unmittelbare physische Folgen; es hinterlässt auch psychische Spuren bei den Betroffenen und in ihrem sozialen Umfeld.
Sachbeschädigungen und Angriffe auf Eigentum stellen eine weitere Kategorie dar. Sie richten sich gegen Privatpersonen, Geschäfte, Treffpunkte politischer Gegner oder Einrichtungen, die als "fremd" angesehen werden. So wollen die Verursacher ein Klima der Furcht und Einschüchterung schaffen.
Auch "Demonstrationsdelikte" sind nicht zu unterschätzen. Rechtsextreme Aufmärsche, Kundgebungen und Versammlungen sind ein Mittel zur Mobilisierung der Szene und gehen oft mit Straftaten wie Landfriedensbruch, Körperverletzung oder dem Einsatz von Pyrotechnik einher. Die Polizei hat hier die schwierige Aufgabe, das Versammlungsrecht zu schützen und gleichzeitig Straftaten zu verfolgen.
Die unterschiedlichen Arten von Delikten belegen, dass rechtsextremistische Straftaten kein Randphänomen sind; sie finden sich in der Mitte der Gesellschaft und beeinflussen das öffentliche Leben in Brandenburg zunehmend.
Brennpunkte rechtsextremer Gewalt: Regionale Verteilung und Hotspots
In Brandenburg ist die Zunahme rechtsextremistischer Straftaten kein flächendeckendes, sondern ein regional unterschiedlich ausgeprägtes Phänomen. Einige Städte und Landkreise sind als Brennpunkte zu betrachten, in denen die Szene besonders aktiv ist und rechtsextreme Gewalt häufiger vorkommt.
Die Stadt Cottbus, die in den letzten Jahren immer wieder durch rechtsextreme Vorfälle in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, gehört zu den bekannten Hotspots. Im Juni 2025 griff eine vermummte Gruppe am Ufer eines Badesees eine andere Gruppe an, nachdem sie rechtsextreme Sticker entfernt hatte; sie warf Flaschen und Pyrotechnik auf sie. Cottbus ist das Zentrum der rechtsextremen Aktivitäten in Südbrandenburg und hat überregionale Verbindungen.
In Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, wurde ein schwerer Angriff gemeldet: Ein Mann verletzte einen ausländischen Mitbürger mit einem Messer im Gesicht. Nach der Tat prahlte der Täter in seinem WhatsApp-Status mit dem, was er getan hatte. Diese Vorfälle beweisen, dass die Täter Gewalt nicht nur gezielt anwenden, sondern sie auch öffentlich zur Schau stellen.
Die Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße wurde zuletzt durch die öffentliche Warnung ihrer Bürgermeisterin Christine Herntier bekannt, die in einem offenen Brief den wachsenden Einfluss rechtsextremer Gruppen in ihrer Stadt thematisierte. Sie rief die Gesellschaft und die Politik dazu auf, das Problem endlich zu konfrontieren.
Selbst in Potsdam, der Landeshauptstadt, sind Übergriffe mit rechtsextremem Hintergrund festgehalten worden. Im April 2025 wurde ein syrischer Lastwagenfahrer von einem deutschen Täter geschlagen und rassistisch beleidigt. Gewaltakte in Städten zeigen, dass rechtsextreme Gewalt nicht nur ein Problem ländlicher Gebiete ist.
Auch in den Landkreisen Barnim, Havelland und Märkisch-Oderland sind die Schwerpunkte, da die Polizei dort eine hohe Zahl von Propagandadelikten und Sachbeschädigungen verzeichnet. Rechtsextreme Gruppen haben in einigen Regionen Rückzugsräume geschaffen, die von der Polizei als schwer kontrollierbar gelten.
Verschiedene Faktoren sind für die regionale Verteilung der Taten verantwortlich: soziale und wirtschaftliche Probleme, eine geringe staatliche Präsenz, eine schwache Zivilgesellschaft und das Vorhandensein von rechtsextremen Netzwerken. Es ist eine zentrale Herausforderung für Polizei und Verfassungsschutz, solche Brennpunkte zu identifizieren und zu überwachen. Um die Szene zu schwächen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern, sind gezielte Maßnahmen erforderlich.
Zivilgesellschaftlicher Widerstand und politische Reaktionen
In Brandenburg formiert sich der zivilgesellschaftliche Widerstand angesichts der steigenden Zahl rechtsextremer Straftaten. Immer mehr Initiativen, Vereine und Einzelpersonen engagieren sich für Toleranz und Vielfalt und stellen sich der rechten Gewalt entgegen. Zur gleichen Zeit wächst der Druck auf die Politik, endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und das Problem nicht zu verharmlosen.
Ein Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement ist das Netzwerk "Brandenburg zeigt Haltung", welches landesweit Aktionen, Mahnwachen und Informationsveranstaltungen organisiert. Die Absicht ist es, den Opfern rechtsextremer Gewalt Solidarität zu zeigen und ein Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung zu setzen. In zahlreichen Städten und Gemeinden arbeiten Bündnisse zusammen, um lokale Präventionsprojekte zu fördern und mit Schulen, Vereinen und Religionsgemeinschaften zu kooperieren.
Auch Menschen, die von rechtsextremer Gewalt betroffen sind, bekommen immer mehr Hilfe. Hilfsorganisationen wie "Opferperspektive" oder "Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus" unterstützen Betroffene bei der Bewältigung von Angriffen und begleiten sie durch juristische und behördliche Verfahren. Diese Hilfe ist besonders wichtig, weil viele Betroffene aus Angst vor weiteren Übergriffen oder gesellschaftlicher Stigmatisierung zunächst zögern, sich öffentlich zu äußern.
Politisch gesehen ist das Thema der rechtsextremen Gewalt jetzt im Mittelpunkt. Abgeordnete aller demokratischen Parteien im Landtag verlangen eine konsequente Strafverfolgung und eine bessere Ausstattung der Polizei. Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack unterstreicht die große Bedeutung der frühzeitigen Identifizierung und gezielten Überwachung von Brennpunkten rechtsextremer Gewalt. Die Landesregierung hat angekündigt, dass sie die Präventionsprogramme erweitern und die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren verbessern wird.
Es gibt jedoch Kritik an der Umsetzung und der Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen. Es gibt Kommunalpolitiker, die dem Land vorwerfen, dass es nicht genug in die Prävention investiert und die Warnungen der Bevölkerung nicht ernst genug nimmt. In einem offenen Brief verlangte Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier, dass man entschlossener handeln und die Gesellschaft stärker für das Problem sensibilisieren sollte.
Die politischen Debatten werden auch durch die Erfolge der rechtsextremen Parteien bei Kommunal- und Landtagswahlen angeheizt. In einigen Gebieten erzielen diese Gruppierungen zweistellige Wahlergebnisse und sitzen in Stadt- und Gemeinderäten. Das erschwert es, einen gesellschaftlichen Konsens gegen Rechtsextremismus zu finden, und erhöht den Druck auf die demokratischen Institutionen.
Es ist entscheidend, die Frage nach einer langfristigen und nachhaltigen Strategie gegen rechtsextreme Gewalt zu stellen. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und den Nährboden für rechtsextreme Ideologien zu entziehen, sind neben repressiven Maßnahmen Prävention, Bildung und der Ausbau zivilgesellschaftlicher Strukturen von entscheidender Bedeutung.
Rolle der Sicherheitsbehörden und Herausforderungen bei der Strafverfolgung
Die Sicherheitsbehörden in Brandenburg haben es schwer, rechtsextreme Straftaten zu bekämpfen. Die Polizei, der Verfassungsschutz und die Justiz arbeiten eng zusammen, um die Täter zu identifizieren, Straftaten zu verfolgen und rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen. Trotzdem existieren strukturelle und praktische Probleme, die die Wirksamkeit der Maßnahmen einschränken.
Ein zentrales Problem ist die Dunkelziffer von Straftaten, die nicht angezeigt oder nicht erkannt wurden. Aus Angst oder Misstrauen scheuen viele Opfer rechtsextremer Gewalt den Weg zur Polizei. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund erzählen von Unsicherheiten im Umgang mit Behörden und einem fehlenden Vertrauen in die Strafverfolgung. Um diese Barrieren zu reduzieren, haben Polizei und Beratungsstellen spezielle Ansprechpersonen für Opfer rechter Gewalt benannt und Informationskampagnen ins Leben gerufen.
Die hohe Mobilität und Vernetzung der rechtsextremen Szene erschwert ebenfalls die Ermittlungen. Überregional tätige Täter treffen sich oft in Chatgruppen und nutzen verschlüsselte Kommunikationswege. Die Polizei setzt spezialisierte Ermittlungsgruppen ein, die sich auf digitale Forensik und die Beobachtung von Online-Plattformen konzentrieren. Analysen und Bewertungen zur Szene liefert der Verfassungsschutz und hilft der Polizei, Gefährder zu identifizieren.
Ein weiteres Problem ist der Mangel an Ressourcen. Die Polizeigewerkschaften und Kommunalpolitiker beklagen trotz der steigenden Fallzahlen, dass das Personal und die technische Ausstattung nicht ausreichen, um alle Delikte umfassend zu bearbeiten. Die Landesregierung hat für 2025 zusätzliche Mittel eingeplant, um Spezialkräfte einzustellen und die IT-Infrastruktur zu modernisieren. Es wird sich erst in den kommenden Monaten herausstellen, ob diese Maßnahmen ausreichen.
Die Justiz hat die Herausforderung, rechtsextreme Straftaten mit Konsequenz zu verfolgen und angemessen zu bestrafen. Die Vergangenheit hat immer wieder Kritik an milderen Urteilen oder langen Verfahrensdauern hervorgebracht. Justizministerin Susanne Hoffmann gab bekannt, dass sie die Fortbildung von Staatsanwälten und Richtern in Bezug auf politisch motivierte Kriminalität ausbauen und die Zusammenarbeit mit Präventionsstellen verbessern will.
Eine weitere Herausforderung für die Sicherheitsbehörden besteht darin, rechtsextreme Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen. Dazu gehören das Verbot rechtsextremer Gruppen, die Überwachung von Treffpunkten und die Beschlagnahmung von Propagandamaterial. Experten heben gleichzeitig hervor, wie wichtig Prävention und Deradikalisierung sind, um potenzielle Täter frühzeitig zu erreichen.
Alles in allem ist es offensichtlich, dass ein umfassender Ansatz notwendig ist, um rechtsextremer Kriminalität zu begegnen: Dieser sollte polizeiliche, justizielle und gesellschaftliche Maßnahmen vereinen. Die Herausforderungen sind weiterhin erheblich, besonders aufgrund der immer wieder sich verändernden Strategien und Kommunikationswege der rechtsextremen Szene.
Rechtsextremismus im digitalen Zeitalter: Neue Formen der Radikalisierung
In Brandenburg hat die rechtsextreme Szene durch den digitalen Wandel einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Online-Plattformen sind nicht nur dafür verantwortlich, dass Propaganda verbreitet wird; sie sind auch zentrale Werkzeuge für die Radikalisierung, Mobilisierung und Organisation geworden.
Das Internet ist ein gezieltes Werkzeug für rechtsextreme Gruppen, um ihre Ideologie zu verbreiten, neue Anhänger zu gewinnen und Aktionen zu koordinieren. In geschlossenen Chatgruppen und Foren verbreiten sich Hassbotschaften, Verschwörungserzählungen und Aufrufe zur Gewalt. Dank der Anonymität im Internet können sich die Täter vernetzen, ohne dass die Behörden sie identifizieren können.
Vor allem bei Jugendlichen ist die Anfälligkeit für rechtsextreme Inhalte im Netz sehr hoch. Die Algorithmen von sozialen Medien bewirken, dass Nutzer mit passenden Interessen immer wieder solchen Inhalte begegnen. Mit professionell produzierten Videos erreichen rechtsextreme Influencer und YouTuber ein großes Publikum und nutzen populäre Themen wie Migration, Corona-Maßnahmen oder die Gender-Debatte, um ihre Ideologie ins Mainstream zu bringen.
Eine wachsende Verzahnung von Online- und Offline-Aktionen wird von Polizei und Verfassungsschutz beobachtet. Das Netz dient zur Koordination von Demonstrationen, Angriffen und Störaktionen; viele dieser Taten werden danach online verherrlicht. Angreifer filmen ihre Attacken oder veröffentlichen Fotos von Schmierereien und Übergriffen, um Gleichgesinnte zu beeindrucken und zur Nachahmung zu animieren.
Ein weiteres Problem ist die globale Vernetzung. Rechtsextreme Gruppen in Brandenburg sind mit Szenen aus anderen Bundesländern und dem Ausland verbunden. Über das Internet tauschen Akteure Strategien aus, verbreiten Propagandamaterial und organisieren finanzielle Unterstützung. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden wird durch diese transnationalen Kontakte erschwert, weshalb eine enge Zusammenarbeit auf nationaler und europäischer Ebene nötig ist.
Digitale Ansätze übernehmen auch eine immer wichtigere Rolle, wenn es um Prävention und Deradikalisierung geht. Initiativen wie "Firewall Brandenburg" oder "Klicksafe" setzen auf Aufklärung, digitale Zivilcourage und den Ausbau der Medienkompetenz. Die frühzeitige Sensibilisierung von Jugendlichen für die Gefahren rechtsextremer Propaganda und die Schaffung von Gegenangeboten im Netz sind die Ziele.
Die Gesellschaft muss sich neuen Herausforderungen im Umgang mit Rechtsextremismus stellen, die durch die Digitalisierung entstehen. Die Szene adaptiert sich schnell an neue Technologien und nutzt die Schwächen der Kontrollmechanismen, die bereits bestehen. Um im digitalen Zeitalter rechtsextremer Kriminalität effektiv zu begegnen, sind daher neue Ansätze nötig, die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Zivilgesellschaft ist unerlässlich, und die Strategien müssen sich fortlaufend an die sich verändernde Online-Landschaft anpassen.
Gesellschaftliche Ursachen und langfristige Präventionsansätze
Die steigenden Zahlen rechtsextremistischer Straftaten in Brandenburg sind eng verbunden mit gesellschaftlichen Entwicklungen und strukturellen Problemen. Verschiedene Faktoren werden von Fachleuten als Ursachen angesehen, die das Entstehen und die Stärkung von rechtsextremen Ideologien begünstigen. Hierzu gehören soziale und wirtschaftliche Benachteiligung, Perspektivlosigkeit, das Empfinden politischer Ohnmacht sowie gesellschaftliche Polarisierung und ein Vertrauensverlust in staatliche Institutionen.
In zahlreichen ländlichen Gebieten Brandenburgs sind Arbeitslosigkeit, das Wegziehen junger Leute und der Rückgang traditioneller Industrien prägende Faktoren. Rechtsextreme Gruppierungen finden in diesen strukturellen Herausforderungen einen fruchtbaren Boden, weil sie mit einfachen Feindbildern, Gemeinschaftserlebnissen und dem Versprechen von Identität und Zugehörigkeit werben. Rechtsextreme Akteure nutzen lokale Konflikte, wie etwa um Flüchtlingsunterkünfte oder Integrationsprojekte, gezielt aus, um Ängste zu schüren und ihre Ideologie zu verbreiten.
Ein weiteres Problem ist die gesellschaftliche Spaltung und die Verschlechterung des öffentlichen Diskurses. Rechtsextreme Ansichten werden in sozialen Netzwerken und sogar im Alltag immer häufiger offen zur Schau gestellt. Dadurch wird es schwieriger, einen gesellschaftlichen Konsens gegen Hass und Gewalt zu finden, und es hilft mit, dass rechtsextreme Straftaten als "normal" oder "legitim" angesehen werden.
Langfristige Präventionsstrategien greifen diese Ursachen auf. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sind entscheidend dafür, dass Toleranz, demokratische Werte und Medienkompetenz gelehrt werden. Es ist wichtig, Schulen und die Jugendarbeit zu stärken und für das Thema zu sensibilisieren. Aufklärungsarbeit und frühzeitige Interventionen können durch Präventionsprojekte wie "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" oder lokale Demokratieförderungsinitiativen als wirksam bewiesen werden.
Es ist auch wichtig, die Zivilgesellschaft zu stärken. Es ist wichtig, dass wir Vereine, Kirchen und Initiativen unterstützen, damit sie ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus fortsetzen und erweitern können. Eine erfolgreiche Prävention basiert auf der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren.
Politisch gesehen sind transparente Kommunikation, Bürgerbeteiligung an Entscheidungen und eine proaktive Auseinandersetzung mit rechtsextremen Tendenzen notwendig. Es ist wichtig, dass Kommunen die Möglichkeit erhalten, schnell auf lokale Probleme zu reagieren und Präventionsarbeit zu leisten.
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Rechtsextremismus zu bekämpfen, und sie braucht Geduld über einen langen Zeitraum. Es sind neben repressiven Maßnahmen auch nachhaltige Investitionen in Bildung, soziale Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt erforderlich, um den Nährboden für Hass, Gewalt und Ausgrenzung dauerhaft zu entziehen.